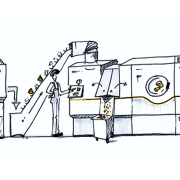Die vermiedene Vermeidung
Vermeidung und Wiederverwendung stehen an erster Stelle der EU-Abfallhierarchie. Doch sind die bisherigen Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Abfallvermeidung sehr überschaubar. Das 29. Kasseler Abfall- und Bioenergieforum diskutierte die Frage, ob eine Zero-Waste-Politik überhaupt zu realisieren ist.
Bis Ende 2013 sollten alle EU-Mitgliedstaaten Abfallvermeidungsprogramme erstellen, schrieb die novellierte Abfallrahmenrichtlinie vor. Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie untersuchte über 100 der inzwischen auf den Weg gebrachten Maßnahmen von Ländern und Nationen. Die Studie ergab, dass für die Phase der Produktion zwei Drittel der Anordnungen aus Informationen bestehen; so entwickelte und führte beispielsweise Finnland ein Materialeffizienz-Tool für Unternehmen ein. Vorschläge zu regulativen und finanziellen Handhabungen wurden nur zu je 17 Prozent gemacht, darunter eine strikte Begrenzung von gefährlichen Stoffen in der Türkei (regulativ) und die Einführung einer Deponiesteuer in Estland zur Verteuerung der Deponierung (ökonomisch). Im Bereich der Abfallvermeidung beim Konsum bestanden die Maßnahmenvorschläge zum überwiegenden Teil (77 Prozent) aus Informationen wie der deutschen Kampagne „Zu gut für die Tonnen“. Ökonomische Eingriffe kamen auf 17 Prozent regulative Vorschläge; die wenigen regulativen Maßnahmen betrafen sämtlich die separate Abfallerfassung.
Kapitalrentabilität 1:4,5
Es existiert eine Reihe von staatlich finanzierten Abfallvermeidungsprogrammen. So hat Brüssel 10,49 Millionen Euro hierfür vorgesehen, England fünf Millionen Euro für Investitionen in Forschung und Entwicklung, Flandern 1,78 Millionen Euro für Vermeidung und Re-Use, Polen 94 Millionen Euro und Ungarn sogar 98 Millionen Euro für strategische Aktionen. Inwieweit die dafür aufgebrachten Mittel ihren Zweck erreicht haben, ist nicht bekannt. In Irland wurde allerdings das National Waste Prevention Programme aufgelegt, dessen Smile-Bauschuttbörse eine Kapitalrentabilität (eingesetzte Mittel zu eingesparten Kosten) von 1:4,5 erwirtschaftet haben soll.
Wie die Studie des Wuppertal-Instituts bilanziert, verfügen immerhin 17 von 27 bisher veröffentlichten EU-Programmen über quantifizierende Indikatoren zur Abfallvermeidung – insgesamt über 300. Jedoch unterscheiden diese sich in Anzahl, Beschreibungstypus und Überwachungsfunktionalität. Im Gegensatz dazu hat Deutschlands erstes Abfallvermeidungsprogramm quantifizierte Indikatoren oder Zielvorgaben; auch beziehen sich die vorgeschlagenen Maßnahmen eher auf den Informationsaustausch als auf Regulative. Für das deutsche Abfallvermeidungsprogramm schlägt das Forschungsinstitut daher eine Kombination aus ergebnisbezogenen abfallstromorientierten und maßnahmenbezogenen Indikatoren vor, um konkreter quantifizierte Zielvorgaben zu formulieren. Die scheinen bitter nötig zu sein, wie es der Berichterstatter des Wuppertal Instituts, Henning Wilts, abschließend ausdrückte: „Zurzeit hinkt die Abfallvermeidung 30 Jahre hinter der Recyclingwirtschaft hinterher.“
Kommt die Null-Abfall-Gesellschaft?
Auch nach Ansicht von Peter Quicker ist Abfallvermeidung eher unter „Utopie“ einzureihen. Die meisten Forderungen der EU-Politik seien „wirre Postulate“ – wie das Ziel des Ausschusses der Regionen nach einer „Null-Abfall-Gesellschaft“ oder der Vision der EU-Kommission, dass es zukünftig „Deponierungen praktisch nicht mehr gibt“. Laut Friends of the Earth soll Restmüll abgeschafft werden und eine „Kreislaufwirtschaft mit geschlossenen Materialkreisläufen“ entstehen – also eine Abfallwirtschaft ohne Restmülltonne, Verbrennung und Deponierung. Ebenso seien die Leitsätze von des Cradle-to-Cradle-Erfinders Michael Braungart – „Alle Produkte sind Nährstoffe“ und „Abfall ist Nahrung“ – ebenso realitätsfern wie die jüngst durch die Presse geisternde Plastik-fressende Raupe. TetraPak (Polyethylen/Aluminium/Karton), mehrschichtige Wärmedämmverbundsysteme oder Kohlenstoffaser-verstärkte Kunststoffverbunde (CFK): Ihr Produktdesign, das bestenfalls Downcycling zulässt, hält Quicker für eine „Katastrophe“. Eine sortenreine und Störstoff-freie Erfassung der Wertstoffe, die Voraussetzung für ein hochwertiges Recycling wäre, sei damit ausgeschossen. Ein „Design for Recycling“ würden die großen Konzerne meist außer Acht lassen.
Lesen Sie nach der Anzeige weiter
Andererseits sei es auch gefährlich, Recycling um jeden Preis zu betreiben: Qualitativ minderwertige oder gar belastete Stoffe dürfen nicht in den Kreislauf zurückgelangen, sondern sollten der Schadstoffsenke anheimfallen. Auch bietet der Einsatz alternativer thermischer Verfahren kaum eine wirtschaftliche Option; lediglich Vorschaltverfahren mit Pyrolyse oder Vergasung sind industriell interessant. Ebenso wenig sei es sinnvoll, den persönlichen Konsum so zu gestalten, dass man sein Leben als Zero Waste Family – mit einer Unzahl von alltäglichen Einschränkungen und Auflagen – einrichten könnte. In Summe bedeutet das, dass auch in optimierten Recyclingverfahren Rest- oder Schadstoffe anfallen, die dem Kreislauf entzogen werden müssen. Sicherlich kann stellenweise – zum Beispiel im Baustoffbereich – das Recycling von Abfallströmen noch verbessert werden. Eine abfalllose Gesellschaft werde es jedoch nie geben.
Nur 23 Prozent Plastik stofflich verwertet
Angesichts steigender Wiederverwertungsraten scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Abfälle weitestgehend verlustfrei in den Kreislauf rückgeführt werden können. So meldete Ende März das Bundesumweltministerium: „Die Recyclingquote für Kunststoffverpackungen steigt bis zum Jahr 2022 von heute 36 Prozent auf 63 Prozent.“ Zurzeit jedenfalls werden nicht einmal 23 Prozent der Kunststoffe, die in den Gelben Sack kommen, stofflich verwertet, hielt Kerstin Kuchta (TU Hamburg-Harburg) dagegen. Und verdeutlichte, dass die Möglichkeiten, alle produzierten Kunststoffabfälle sortenrein zu recyceln, begrenzt sind.
In Deutschland werden pro Jahr rund zehn Millionen Tonnen Kunststoffe verbraucht; daraus entstehen 5,9 Millionen Tonnen an Abfällen, davon eine Million Tonnen postindustriell und 4,9 Millionen Tonnen von privaten und gewerblichen Endverbrauchern. Die im Gelben Sack gesammelten Kunststoffe – Sammelquote 50 Prozent – machen dabei rund 60 Prozent der Materialien aus, doch besteht das Material neben recycelbaren Kunststoffsorten auch zu einem nicht geringen Teil aus Mischkunststoffen. Zu ihrer Verwertung stehen aufwändige Verfahren zur Verfügung, doch sind in der Praxis auch Ausschussraten von 40 bis 50 Prozent möglich, zumal der Störstoffanteil in Mischkunststoffen in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat.
Kaskadierte Nutzung möglich
Sortenrein erfasstes Plastik lässt sich, wie das Rezyklat der „Frosch“-Flaschen von Werner & Mertz zeigt, in den Kreislauf zurückführen. Doch mindern schon fünf oder zehn Prozent zugegebenes ABS die Dehnbarkeit von PP um 50 beziehungsweise 97 Prozent, während ABS bei fünf- beziehungsweise zehnprozentiger Verunreinigung durch PP über zehn Prozent seiner Zugfestigkeit und 75 Prozent seiner Bruchdehnbarkeit einbüßt. Insgesamt erschweren Erfassungsverluste und Material-Einschränkungen durch Produktgestaltung, Veschmutzung und Vermischung das Recycling von Kunststoffen. Eine kaskadierte Nutzung von Rezyklaten in Qualitätsstufen wäre – in Grenzen – möglich. Das Urteil von Kerstin Kuchta ist eindeutig: „Kunststoffe sind nur beschränkt kreislauffähig.“
Produktverantwortung gehört zu den Produzenten
„Wir dürfen nicht alles dem Abfall zuschieben“, postulierte Helmut Maurer in seinem Vortrag über die Perspektiven der Kreislaufwirtschaft. Jedes Produkt, das vom Fließband kommt, ist auch potenzieller Abfall. Wer sich beim Design eines Produkts keine Gedanken darüber macht, dass daraus eines Tages Abfall wird, schafft ein Problem. Ein Problem, das von der Produktionsseite – dort, wo es entstanden ist – in den Abfallsektor verlagert wird. Das sei nicht länger tragbar. Alle politischen Weichenstellungen müssten darauf ausgerichtet sein, diesen Mechanismus zu durchbrechen und die Produktverantwortung wieder richtig zu definieren. Und dorthin zu schaffen, wo sie hingehört: zu den Produzenten. Ein Produzent sollte seine Ware nur dann auf den Markt bringen dürfen, wenn er nachweisen kann, dass sie optimal recycelbar ist. Heute bedeutet Produktverantwortung lediglich, in eine Kasse einzuzahlen, von der niemand genau weiß, was mit dem Geld geschieht. Produktverantwortung müsste aber den Gesamtprozess im Auge haben: vom Schürfen der Rohstoffe bis zum Verkauf des Produkts und dem Wiedereinsammeln der Wertstoffe, mit einer unabdingbaren Getrenntsammlung.
Kreislaufwirtschaft als globales Thema ist nach Maurers Ansicht kein Ziel, sondern eine Methode, die auf die Reduktion von Überproduktion und auf die Vermeidung von Abfällen ausgerichtet sein sollte. Doch geschieht in dieser Hinsicht auf nationaler und globaler Ebene praktisch nichts – zu wenig und nicht intensiv. Aus Angst vor Umsatzeinbußen. Daher würden weiterhin zu viele Dinge von zu schlechter Qualität produziert – auf Kosten der globalen Ressourcen und des Klimaschutzes. Dabei ist es wissenschaftlich unumstritten, dass 82 Prozent Kohle, 33 Prozent Öl und 49 Prozent Gas im Boden bleiben müssen, wenn die Klimaschutzziele von Paris erreicht werden sollen. Stattdessen kann in den USA ein Präsident den Klimawandel als ausländische Propaganda abtun. (Dessen Außenminister Rex Tillerson von einer Rechtsanwältin in Massachusetts wegen Anlagebetrugs angeklagt wird, weil er als ehemaliger Exxon-Chef den Aktionären Aktiva auf Rohstoffe vorgegaukelt hat, die laut Paris-Abkommen nicht mehr geschürft werden dürfen.)
Nur schwache Signale aus der Politik
Auch was die Europäische Union im sogenannten Kreislaufwirtschaftspaket vorschlägt, seien zu 90 Prozent nur Visionen, Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen. Es werden jedoch klare Maßnahmen benötigt. Denn es herrschen – nicht nur – in Europa ungleiche Bedingungen: die Rohstoffe sind unterschiedlich teuer, die Arbeitskosten sind es, und auch die Sozialstandards. Die Produzenten sehen sich zu einem Bottom Race gezwungen – eine Abwärtsspirale, in der jeder versucht, möglichst billig herzustellen und möglichst viel zu vermarkten. Um diese Spirale nach unten zu beenden, sollte die Politik aktiv werden. Durch die Festlegung von qualitativen Mindeststandards wären gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Beim Produktdesign müssten Haltbarkeit, modularer Aufbau und das Fehlen toxischer Substanzen berücksichtigt werden. Dem Wildwuchs bei der Erfassung von Abfällen und dem Potpourri verschiedener Sammelmodellen müssten einheitliche und flächendeckende Standards Einhalt gebieten. Und durch die Besteuerung der verbrauchten Rohstoffe und Energien könnte ein Paradigmenwechsel hin zu einer Internalisierung externer Kosten vollzogen werden. Insgesamt – so Maurer – sende die EU zwar viele, aber für sich genommen schwache Signale in diese Richtung aus. Grundsätzliche Änderungen seien noch nicht angepackt worden. „Wir machen Fortschritte, aber viel zu langsam.“
Die Beiträge von Henning Wilts und Peter Quicker sind nachzulesen unter Bio- und Sekundärrohstoffverwertung XII, hrsg. Klaus Wiemer, Michael Kern, Thomas Rausssen, Witzenhausen 2017, ISBN 3-928673-74-2.
Foto: Marc Weigert
(EUR0617S6)