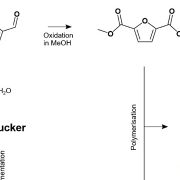Abfallverbringungen innerhalb der EU: Behördlicher Spießrutenlauf oder funktionierender Binnenmarkt?
Die Abfallverbringungsverordnung der Europäischen Union aus dem Jahr 2006 ist renovierungsbedürftig. Offensichtlich benötigen aber auch die Genehmigungsverfahren der Behörden für grenzüberschreitende Abfalltransporte dringend eine grundlegende Überholung.
Das machte eine Online-Diskussionsrunde am 29. April deutlich, zu der der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. (BDE), die Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) und der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) eingeladen hatten.
Nach den Vorstellungen der EU-Kommission zum European Green Deal soll die Europäische Union bis 2050 klimaneutral sein. Dieses Ziel ist im Circular Economy Action Plan präzisiert. Er sieht eine Ausweitung der Kreislaufwirtschaft auf die etablierten Wirtschaftsakteure, eine Verdoppelung des Anteils kreislauforientiert verwendeter Materialien sowie einen gut funktionierenden Binnenmarkt für hochwertige Sekundärrohstoffe vor. Das gegenwärtige Verbringungsrecht entspricht dieser Zielsetzung keineswegs, meinte Rechtsanwalt Anno Oexle von der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft e. V. Für ihn stellt die aktuelle Gesetzgebung vielmehr ein „Recycling-Hemmnis“ dar.
Notifizierungsverfahren ohne Not ausgeweitet
Als erstes bemängelte Oexle, dass die Behörden das zur grenzüberschreitenden Abfallbeförderung erforderliche Notifizierungsverfahren in den letzten 15 Jahren ohne Not kontinuierlich ausgeweitet haben. Es umfasst heute nicht mehr nur Abfälle zur Beseitigung oder Abfälle mit besonderem Gefahrenpotenzial, sondern auch recycelbare Sekundärrohstoffe ohne ausgewiesenes Gefahrenpotenzial. Während die Abfallverbringungsverordnung der EU weitgehend unverändert blieb und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2020 pauschale Grenzwerte für unzulässig erklärt, verringerten die Behörden den zugelassenen Anteil notifizierungsfreier grün-gelisteter Abfälle von ursprünglich 15 bis zehn Prozent auf jetzt zwei bis ein Prozent „fremdstofffreie“ Abfälle.
Verfahren übermäßig komplex
Als zweites kritisierte der DGAW-Vertreter die Vorab-Genehmigungsverfahren für grenzüberschreitende Transporte als übermäßig komplex, zeitintensiv und teuer. Bei dem Vorgang sind verschiedene Behörden in verschiedenen Staaten – am Versandort, am Bestimmungsort und in den Transitstaaten – beteiligt. Jede Behörde arbeitet für sich, kann gegebenenfalls Informationen nachfordern, muss jedoch auch die anderen Behörden informieren, prüfen und bestätigen lassen. Der Transport darf erst stattfinden, wenn alle Ämter zugestimmt haben. Auch beim nachgeschalteten Begleitscheinverfahren sind nochmals diese Institutionen und zusätzlich die Anlagenbetreiber zur vorläufigen und/oder endgültigen Verwertung eingebunden.
20.000 Euro pro Behörde und Vorgang
Als wäre dieses Verfahren nicht aufwändig genug, sind die erzielten Genehmigungen für die Anlagennutzung (mindestens zwei pro Abfallart und Zielanlage) auch nur für ein Jahr gültig; lediglich bei seltenen Anlagen mit Vorabzustimmung kann diese Frist auf drei Jahre verlängert werden. Das erfordert in der Praxis fortlaufende Folgenotifizierungen, um auch im nächsten Jahr noch handlungsfähig zu sein. Hinzu kommt, dass die Dauer des Notifizierungsverfahrens wenigstens drei Monate beträgt, möglicherweise aber auch ein Jahr dauern kann. Zusätzlich fallen Gebühren an: Für Notifizierung beziehungsweise Genehmigung sollen deutsche Behörden bis zu 20.000 Euro pro Amt und Vorgang fordern; dabei sind Personalkosten für die Zusammenstellung der Unterlagen sowie Kosten für Sicherheitsleistung, Beprobung und Analyse seitens des Unternehmens noch nicht einkalkuliert.
Kein Schutz vor behördlichem Vollzug
Der dritte Punkt, den Oexle ansprach, bezog sich auf den fehlenden Rechtsschutz für betroffene Unternehmen. Es fehlt ein Korrektiv, mit der sich der Abfallverbringer vor behördlichem Vollzug schützen kann. Denn beim aktuell herrschenden Verbringungsrecht sind Klagen in mehreren Mitgliedstaaten erforderlich, um eine Verbringung zu realisieren. Diese Verfahren können sich über mehrere Jahre hinziehen und Anwalts- und Gerichtskosten aufwerfen. Einzelunternehmen verfügen zudem über keinen direkten Zugang zum Europäischen Gerichtshof.
Offensichtlich werden innerstaatliche und innereuropäische Abfallverbringungen – wie im Circular Economy Action Plan postuliert – keinesfalls gleich behandelt. Während ein innerstaatliches Transportverfahren beispielsweise von Dresden nach Aachen lediglich die Kennzeichnung mit einem „A-Schild“ erfordert, benötigt eine Verbringung von Dresden ins 40 Kilometer weiterentfernte belgische Lüttich die Erfüllung zwischenstaatlicher Anforderungen einschließlich Notifizierungsverfahren samt Begleitscheinanträgen.
Mehr Bürokratie – mehr Umweltschutz?
Ob diese Ungleichgewichtung gerechtfertigt ist, fragte sich Rechtsanwalt Oexle. Besteht etwa zwischen innerstaatlicher und innereuropäischer Abfallverbringung ein unterschiedliches Gefährdungspotenzial? Nein lautet die Antwort, denn die Abfallzusammensetzung ist identisch. Haben die anzufahrenden Anlagen zur Abfallbehandlung unterschiedliche gesetzliche Standards? Nein, denn es gelten EU-weit einheitliche Standards wie zum Beispiel die Industrieemissions-Richtlinie, die auf hohem Niveau Mensch und Umwelt unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips schützen. Und ist Misstrauen in den Vollzug anderer EU-Mitgliedstaaten gerechtfertigt? Nochmals nein, denn die gegenseitige Anerkennung gehört zu den Grundideen der Europäischen Union.
Mehr Bürokratie bedeutet keineswegs sofortigen maximalen Umweltschutz. So sind Mehrfachprüfungen beispielsweise hinsichtlich der Genehmigung einer Zielanlage redundant. Zudem stellen unredliche Unternehmen keinen Antrag auf Exportgenehmigung, wenn sie Abfälle im Ausland illegal entsorgen wollen. Aufgrund des harmonisierten Umweltrechts des EU können an Verbringungen innerhalb Europas geringe Anforderungen gestellt als an Exporte in Nicht-EU-Staaten. Insgesamt – so Oexles Fazit – würden einfachere Regelungen die betreffenden Unternehmen ebenso wie den behördlichen Vollzug entlasten und die Kreislaufwirtschaft fördern.
Bearbeitungsdauer bis zu zehn Monaten
Für Entlastungen plädierte auch Christoph Ortner, Bereichsleiter bei der Loacker Recycling GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Götzis, Österreich ist mit 25 Firmen und 40 Betriebsstätten in sieben Ländern aktiv. Sieben Mitarbeiter sind ständig für den Transport von zwei Millionen Tonnen jährlich mit etwa 120 laufenden Notifizierungen befasst, von denen 80 pro Jahr auslaufen.
Die Schwierigkeiten bei den Verbringungen bestehen laut Ortner in drei unterschiedlichen Abfallcodes in Österreich, Deutschland und der Schweiz, unterschiedlicher Auslegung der Abfallverbringungsverordnung – speziell der Grünen Liste – trotz einheitlicher europäischer Regelung, einer Bearbeitungsdauer von vier bis zehn Monaten pro Notifizierung, einer steigenden Zahl beizubringender Unterlagen und auch in neu verordneten Umdeklarierungen von Abfallgruppen. Für wünschenswert hält Ortner längere Laufzeiten für erteilte Genehmigungen, eine stärkere Digitalisierung des Schriftverkehrs, eine Vereinheitlichung der Fremdstoffgrenzen sowie eine Reduzierung der erforderlichen Probelieferungen.
Für einen komplett freien Warenverkehr
Oliver Groß, Vorstandsvorsitzender der Nehlsen AG, trat aus drei Gründen ein für einen komplett freien Warenverkehr in der Entsorgung – nicht nur für Recyclingstoffe, sondern auch für brennbare Abfälle. Erstens kennen Emissionen keine Grenzen, weswegen Abfälle und Rezyklate grundsätzlich in die ökonomisch wie ökologisch effizienteste Anlage gehören, die – wo auch immer sie steht – auch länderübergreifend beliefert werden sollte. Zweitens sind Recyclingmaterialien, Abfälle und sogar Rohstoffe wichtige Importe für die Industrie. Und drittens belasten grenznahe Anlagen die Umwelt sehr viel weniger, da neben der Effizienz einer Anlage auch ihre Entfernung eine Rolle spielt, sodass im Hinblick auf die CO2-Gesamtbelastung nicht in Ländergrenzen gedacht werden darf.
Zu den weiteren Forderungen zählte Groß die maximale Ausweitung der Grünen Liste für Rezyklate sowie eine größere Flexibilität, Beschleunigung und Erleichterung bei den Notifizierungsverfahren, um durch schnelleres Handeln für und bei Sekundärrohstoffen Lieferketten geschlossen zu halten.
„Just in time“ nicht realisierbar
Angesichts von mehreren Monaten Bearbeitungszeit für Notifizierungsverfahren sei „just in time“ und damit beispielsweise die Belieferung der Automobilindustrie mit Sekundärrohstoffen nicht realisierbar; ebenso würde die länderspezifische Notifizierung für Handelshemmnisse sorgen. Auch die Festlegung von Störstoff-Anteilen bei den diversen Arten von Kunststoffen, die sowohl aus dem post-production- wie aus dem post-consumer-Bereich stammen, hält Groß für in der Praxis untauglich; bestenfalls sei die Festlegung von eindeutigen Handelsqualitäten nach Kunststoffart denkbar. In jedem Fall muss der Warenverkehr für die Entsorgungswirtschaft offen, flexibel und praktikabel sein, um die Lieferketten geschlossen zu halten, während der CO2-Ausstoß reduziert und der Einsatz von Sekundärrohstoffen gefördert werden kann. Dabei darf nicht an Ländergrenzen Halt gemacht werden.
Europa-weit einheitliche Grenzwerte?
Auf nationale Unterschiede in der Behandlung von grenzüberschreitenden Transporten wies schließlich Gernot Lorenz hin, Ministerialrat im österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz und Umwelt. So hat Österreich beispielsweise die Grenzwerte für einzelne Abfallströme im Bundeswirtschaftsplan festgelegt; in letzter Zeit mussten aufgrund von Vorfällen für Kunststoffe strengere Vorgaben eingeführt werden.
In diesem Zusammenhang plädierte Lorenz für die Einführung Europa-weit einheitlicher Grenzwerte; eine entsprechende Festlegung für die Verunreinigung von Kunststoffen werde seitens der EU vorbereitet. Für die Verbringung von Recyclingmaterialien in Drittstaaten sollte es härtere Vorgaben und Kontrollen oder sogar Verbote geben. Hier herrscht sowohl bei Kunststoffen wie auch bei Elektro- und Elektronikabfällen Handlungsbedarf.
Digitalisierung ist die Zukunft
Doch auch innerhalb Europas gibt es unterschiedlich ausgebaute Entsorgungs-Infrastrukturen. Zwar funktioniert die Kreislaufwirtschaft im Bereich des Recyclings und der Verwertung jeweils national, jedoch sollte auf dem Gebiet der Beseitigung eine EU-weit einheitliche Struktur aufgebaut werden. Uneinheitlichkeit herrscht auch bei der Definition und Einstufung von Nebenprodukten; hier könnte eine Datenbank auf EU-Ebene zu mehr Vergleichbarkeit und Transparenz führen. Nach Ansicht von Lorenz sollte der Artikel 28 Verbringungsverordnung umgesetzt werden, wonach bei Transporten zwischen zwei Staaten das strengere Verfahren zum Tragen kommt. Prinzipiell setzt das Ministerium auf stärkeren elektronischen Datenaustausch bei Unterlagen und Meldungen von Notifizierungen. In einem Projekt mit der Schweiz werden etliche Vorgänge bereits digitalisiert und führen zu Erleichterungen. Lorenz: „Digitalisierung ist die Zukunft“, da sie unter anderem zur Beschleunigung der Verfahren dient.
Ein Schengen-Raum für Abfälle?
Nach der anschließenden Diskussionsrunde sprach sich Anno Oexle explizit für einen von der Notifizierung befreiten Schengen-Raum für Abfälle aus. Der von der Politik geforderte Binnenmarkt funktioniere nicht, wenn man ihn durch bürokratische Verfahren erschwert, die unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen. Wobei der innereuropäische Transport von Sekundärrohstoffen genauestens getrennt werden müsse von einer Überführung zur Beseitigung in Dritt-Staaten. Die neuen schärferen Regelungen für Kunststoffe, die auf Grundlage des Baseler Abkommens zur Kontrolle gefährlicher Abfälle entstanden, hätten mit innereuropäischen Verbringungen von Sekundärrohstoffen nichts zu tun und taugten nicht als Vorlage für Notfizierungsverfahren.
Es wird noch einige Wochen, wenn nicht Monate dauern, bevor die EU-Kommission ihren Verordnungsvorschlag veröffentlicht. Doch: „Das Thema ist eines der zentralen, auch für die Erreichung der Ziele der Kreislaufwirtschaft. Insofern bleibt es ein Schwerpunktthema“, bilanzierte BDE-Präsident Peter Kurth, der die Veranstaltung am 29. April moderierte. Und er fügte abschließend hinzu: „Es dürfte allen klar geworden sein, wie wichtig das Thema ist.“
(Erschienen im EU-Recycling Magazin 06/2021, Seite: 6, Foto: moodboard / stock.adobe.com)